 |

 Studium Integrale Journal
Studium Integrale Journal
8. Jahrgang / Heft 2 - Oktober 2001
Seite 98 - 104
Vermitteln die fossilien Zeugnisse vergangenen Lebens, der „Fossilbericht“, ein wahres Bild der Geschichte des Lebens? Dieser Frage gingen BENTON et al. (2000) in einer groß angelegten Studie nach. Man könnte erwarten, daß der Fossilbericht umso lückenhafter und weniger repräsentativ ist, je älter die Gesteine sind, welche die Fossilien bergen. Denn je älter die Gesteine sind, desto eher sollten sie durch nachfolgende Erosion, durch Aufschmelzen, durch Subduktion oder andere Ereignisse zerstört worden oder unauffindbar geworden sein.
Die Qualität des Fossilberichts ermittelten Benton et al. durch einen Vergleich zwischen dem ersten Auftreten in der Schichtenfolge (Stratigraphie) und der Position in evolutionären Ähnlichkeitsbäumen, die durch Merkmalsvergleiche (unabhängig von den stratigraphischen Positionen) ermittelt werden (Phylogenie). Die „Qualitätsprüfung“ setzt also ein evolutionstheoretisches Szenario voraus. Im (evolutionstheoretischen) Idealfall ergeben sich in beiden Fällen (Stratigraphie und Phylogenie) dieselben Daten. In der Praxis liegen die phylogenetisch ermittelten Verzweigungspunkte (die also auf dem Merkmalsvergleich basieren) häufig deutlich tiefer als das erstmalige fossile Auftreten. So legen molekulare Studien beispielsweise nahe, daß Vögel und Säugetiere viel früher entstanden sind (bis zu drei- oder viermal früher) als nach dem Fosslbericht dokumentiert ist. (Die Gründe für diese Diskrepanz sollen hier nicht diskutiert werden.) Der Unterschied zwischen Phylogenie und Stratigraphie kann durch verschiedene Indices quantitativ angegeben werden.
BENTON et al. verglichen nun 1.000 publizierte Phylogenien (also durch Merkmalsvergleich erstellte Ähnlichkeitsbäume) mit der Stratigraphie und stellten dabei fest, daß es über die gesamte Erdgeschichte ab dem Phanerozoikum (dem hauptsächlichen Beginn weltweiter Überlieferung vielzelligen Lebens) kaum größere Unterschiede in der Qualität der Fossilüberlieferung gibt. Insbesondere ist (für die Autoren überraschenderweise) kein Rückgang der Qualität in älteren Fossilgruppen festzustellen. BENTON et al. (2000, 534) stellen fest: „If scaled to the stratigraphic level of the stage and the taxonomic level of the family, the past 540 million years of the fossil record provide uniformly good documentation of the life of the past.“ Die Autoren diskutieren eine Reihe von Einwänden, z. B. eine Abhängigkeit der Ergebnisse vom taxonomischen Level der untersuchten Gruppe (Gattung, Familie, Ordnung), können sie aber allesamt entkräften. Sie schließen ihre Untersuchung mit folgendem Ergebnis: „Early parts of the fossil record are clearly incomplete, but they can be regarded as adequate to illustrate the broad patterns of the history of life“ (S. 536). Dieses Ergebnis relativiert – neben der Tatsache, daß ca. 250.000 fossile Arten beschrieben sind – die Argumentation der Lückenhaftigkeit des Fossilberichts angesichts des Fehlens geeigneter evolutionärer Übergangsformen.
Kommentar: Das Ergebnis, das BENTON et al. präsentieren, ist nicht überraschend, wenn man sich die Geologie Mitteleuropas vor Augen hält. Die gefalteten paläozoischen Komplexe wie das Rheinische Schiefergebirge waren nie tief versenkt. Sie sind zwar gefaltet und geschiefert, aber (bis auf regionale Bezirke wie die metamorphe Zone am Taunus-Südrand) nur schwach metamorph verändert worden. Etwas tiefer versenkt wurde der Harz, denn er war vor der späteren Heraushebung von Mesozoikum bedeckt. Aber er war nur so tief abgesenkt, daß sein Fossilbestand größtenteils gut erhalten blieb. Tief versenkt und praktisch unzugänglich (und damit bezüglich des Fossilbestandes nicht überprüfbar) ist das Paläozoikum zwischen diesen herausgehobenen Komplexen und nördlich davon, etwa unter dem Norddeutsch-Polnischen Trog. Dort wird es von mächtigen Meso-Känozoischen Schichtfolgen überlagert. Mehrere paläozoische Komplexe (wie London-Brabanter Massiv oder Rheinische Insel) werden auf den paläogeographischen Karten zur Zeit der Ablagerung des Mesozoikums als Festland bzw. Inseln dargestellt, waren also zumeist „oben“. Dort, wo Altpaläozoikum (wie im Schwarzwald, im Böhmerwald oder den Alpen) aber in großen Tiefen durch Druck bzw. Temperatur wirklich metamorph umgewandelt wurde, sind natürlich keine Fossilien mehr zu finden.
[BENTON MJ, WILLS MA & HITCHIN R (2000) Quality of the fossil record through time. Nature 403, 534-537.]
RJ/MS
|

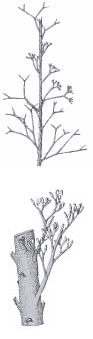 |
Abb. 1: Octopus spec. mit kontrastreicher Färbung | |
Evolutionstheoretiker wundern sich darüber, daß die Pflanzen nach der Eroberung des Landes für die Ausbildung flächiger Blätter so lange brauchten. Die ersten fossil überlieferten Landpflanzen sind aus dem Silur bekannt; im Unterdevon tritt dann eine große Formenfülle auf. Die meisten unter- und mitteldevonischen Landpflanzen sind jedoch blattlos oder besitzen nur kurze, längliche Blättchen, sog. Mikrophylle. Pflanzen mit flächigen Blattspreiten sind dagegen sehr seltene Ausnahmen. Erst im Oberdevon – mindestens 40 Millionen Jahre (gemäß üblicher Datierung) nach dem Auftreten der ersten Landpflanzen – und später kommen größere flächige Blätter verbreitet vor. Da die Bildung flächiger Blätter von verzweigten Sprossen ausgehend als vergleichsweise einfacher evolutiver Prozeß angesehen wird, war ihr spätes Auftreten rätselhaft. Jedenfalls kommen im Laufe des Devons ungleich komplexere Organe erstmals in der Fossilüberlieferung vor, z. B. im Bereich der Leitgewebe oder der Fortpflanzungsorgane.
BEERLING und Mitarbeiter versuchten mittels Computersimulationen dem Rätsel des späten Auftauchens flächiger Blätter auf die Spur zu kommen. Früheren geochemischen Untersuchungen zufolge nahm der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre im Laufe des Devons um 90% ab. Die anfangs noch hohen CO2-Konzentrationen sollen der Ausbildung flächiger Blätter entgegengewirkt haben, weil sich die Pflanzen aufgrund zu starker CO2-Aufnahme sonst zu stark überhitzt hätten. Aus diesem Grunde seien bei den frühen Landpflanzen auch nur relativ wenige Spaltöffnungen, durch die der Gasaustausch mit der Umgebung reguliert wird, ausgebildet gewesen. Erst nachdem gegen Ende des Devons der Kohlendioxidgehalt durch die Tätigkeit der Landpflanzen stark verringert war, wurde eine Vergrößerung der Blattflächen und eine Zunahme der Anzahl der Spaltöffnungen opportun.
Die Anatomie der devonischen Landpfanzen ist also mindestens zu einem erheblichen Teil ökologisch zu begründen. Im Rahmen einer Schöpfungslehre könnten diese Befunde in einem nicht-evolutionären Szenario gedeutet werden. Die Abfolge der Fossilüberlieferung der devonischen Pflanzenwelt läßt sich kaum in Stammbäume fassen (vgl. JUNKER 1996). Alternativ könnte an eine (Wieder-)Besiedlung nach katastrophischer Auslöschung der Lebensräume gedacht werden, in deren Verlauf sich die ökologisch „passenden“ Arten zuerst ausbreiteten, während die anderen folgten, nachdem sich die Bedingungen entsprechend geändert hatten. Die Vorstellung, daß die Überlieferung der devonischen Landpflanzen auf sukzessives Einwandern in die Überlieferungsgebiete zurückzuführen ist und nicht auf sukzessive evolutionäre Prozesse, wurde von Paläobotanikern gelegentlich geäußert (zusammenfassend in JUNKER 1996, S. 76-78), blieb jedoch immer eine Minderheitenmeinung. Im Rahmen der Schöpfungslehre könnte diese Überlegung jedoch wichtig werden.
[BEERLING DJ, OSBORNE CP & CHALONER WG (2001) Evolution of leaf-form in land plants linked to atmospheric CO2 decline in the Late Palaeozoic era. Nature 410, 352-354; JUNKER R (1996) Evolution früher Landpflanzen. Neuhausen-Stuttgart.]
RJ
|

|
Doppelt genäht hält besser – das gilt für die Lungenfische in Beug auf das Atmen, denn sie können außer durch Kiemen auch mit einfach gebauten Lungen atmen, die sie bei Trockenheit – eingegraben in Schlamm – nutzen. Die im Devon verbreiteten Fische haben bis heute in drei Gattungen in Australien, Afika und Südamerika überlebt. Aber noch in manch anderen Mermalen sind die Lungenfische eigenartig, weshalb sie nicht in eine nähere stammesgeschichtliche Beziehung zu den Vierbeinern gebracht werden können. Eines dieser Merkmals ist die Bezahnung. Die erwachsenen Fische besitzen keine richtige Mundrandbezahnung, sondern mehrreihige, flächige Zahnplatten, somit ein Malmgebiß. Die jugendlichen Tiere bilden zwar ein „normales“ Milchzahngebiß aus, doch fallen diese Zähne in der weiteren Entwicklung nach einem bestimmten Muster aus. Dieser seltsame Zahnwechsel konnte nun auch bei zahlreichen sehr gut erhalten fossilen Lungenfischen aus dem Devon nachgewiesen werden. Dieser bemerkenswerte Befund zeigt, daß das Entwicklungsprogramm für die Bezahnung bei den Lungenfischen einheitlich ist, einzigartig und unverändert für alle Zahnfelder, stellen REISZ & SMITH (2001) fest, die den Zahnwechsel bei den fossil erhaltenen Tieren untersucht haben. Sie verglichen die Zahnentwicklung bei der heute vorkommenden Gattung Neoceratodus mit der devonischen Gattung Andreyevichthys.
[REISZ RR & SMITH MM (2001) Lungfish dental pattern conserved for 360 Myr. Nature 411, 548.]
RJ
|

|
„Tintenfische sind schon äußerlich so verschieden von [...] Wirbeltieren, daß viele Menschen sie intuitiv als primitive Lebewesen bezeichnen“, so ein Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 5. 9. 2001. Dem scheint aber doch nicht so zu sein. Im Verhältnis zum Körper liegt die Gehirngröße beim Octopus im Bereich vieler Vögel und Säugetiere. Die Tiere sind sehr gelehrig und sie verständigen sich durch optische Muster auf der Haut, die sie willentlich verändern können. Vor kurzem konnte eine Seiten-Bevorzugung ähnlich der Rechts- oder Linkshändigkeit beim Menschen nachgewiesen werden. Schwimmt eine Beute am „falschen“ Auge vorbei, so drehen die Kraken den Kopf, bis sie mit ihrem bevorzugten Auge die Beute anvisieren können. Die Bevorzugung eines Auges führt auch dazu, daß die Tiere zwei entsprechende Fangarme häufiger benutzen, welche dann auch stärker pigmentiert sind. Dies ist der erste Nachweis einer solchen Asymmetrie bei Wirbellosen. Die Tiere sind aber auch zu räumlichem Sehen fähig, wenn sie beide Augen auf das zu betrachtende Objekt richten. [Abstracts of the XXVII International Ethological Conference, Tübingen, Germany]
KN
|

|
Um lange Flugreisen erfolgreich bestreiten zu können, benötigen Flugvögel faszinierende Fähigkeiten. Auf dem Flug müsssen sie möglichst sparsam mit der chemisch gespeicherten Energie haushalten. Auf Zwischenstationen gilt es dann möglichst schnell neue Fettreserven anzulegen. In sehr kurzer Zeit muß der Körper daher sehr verschiedene Strategien verfolgen, was eine enorme Flexibilität erfordert: Die „Flugmaschine“ muß schnell in eine „Freßmaschine“ umgerüstet werden und umgekehrt.
Schon länger war vermutet worden, daß Organe, die für den Flug nicht benötigt werden, auf ein Minimum zurückgebildet werden. Diese Veränderungen untersuchten die Ornithologen Åke LINDSTRÖM, Marcel KLAASSEN und Anders KVIST von der Universität Lund mit einem Simulationsexperiment: sie simulierten einen 6300 Kilometer langen, in Etappen aufgeteilten Flug eines Sprossers (Luscinia luscinia) im Windkanal – ein solcher Versuch war zuvor noch nicht durchgeführt worden. Während der Rastzeiten wurden Nahrungsverhalten, Stoffwechsel und Organveränderungen untersucht. Es stellte sich heraus, daß der Vogel trotz sofortiger Nahrungsaufnahme in den Rastzeiten erst am zweiten Ruhetag seine Fettdepots auffüllte. Dies dürfte damit zusammenhängen, daß sich erst ab dem zweiten Tag Magen, Darm und Flugmuskeln wieder vergrößerten. Der Zeitraum des vorherigen Abbaus der Verdauungsorgane konnte jedoch noch nicht ermittelt werden.
Es stellt sich angesichts solcher Flexibilität die Frage, wie sie entstanden sein kann. LINDSTRÖM et al. (1999, 352) sprechen davon, daß natürliche Selektion eine solche phänotypische Flexibilität begünstigt habe. Allerdings machen sie dazu keine näheren Angaben, weder über die Anzahl der dazu benötigen Mutationen noch wie die kurzfristige Abfolge der gegensätzlichen Veränderungen des Magens und der Flugmuskulatur erreicht worden sein könnte.
[LINDSTRÖM A, KLAASSEN M & KVIST A (1999) Variation in energy intake and basal metabolic rate of a bird migrating in a wind tunnel. Functional Ecology 13, 352-359. ]
RJ
|

|
Die Vorgänger der Zuchttomaten (Lycopersicon esculentum) hatten wahrscheinlich Früchte mit einem Durchmesser von deutlich unter 1 cm – geradezu winzig, gemessen an den großen Tomaten im heimischen Garten. Es ist eine große Zahl von Erbanlagen bekannt, welche Einfluß auf die Größe der Früchte haben. Nun haben Anne FRARY und Mitarbeiter von der Cornell University in Ithaka ein Gen entdeckt, dessen Gegenwart oder Fehlen eine sprunghafte Veränderung der Fruchtgröße zur Folge hat. Die Früchte der Zuchttomate werden um ca. ein Drittel kleiner, wenn man ihnen das Gen fw2.2 der Wildtomate L. pennellii einpflanzt. Die Autoren vermuten, daß dieses Gen bei der Domestizierung eine Schlüsselrolle spielte, da alle bisher untersuchten Wildtomaten dieses Gen besitzen, während die Zuchtformen an dessen Stelle ein anderes Allel (Genvariante) haben, das große Früchte ermöglicht, vermutlich infolge Veränderungen in der Regulation der Wachstumsvorgänge. „Kleine Ursache – große Wirkung“ ist ein Mittel zur Erzeugung beträchtlicher Vielfalt innerhalb von Grundtypen. [FRARY A, NESBITT C et al. (2000) fw2.2: A quantitative trait locus key to the evolution of tomate fruit size. Science 289, 85-88.]
RJ
|

|
Pflanzen überraschen immer wieder durch beeindruckende Fähigkeiten als Überlebenskünstler. So können Samen mancher Pflanzenarten noch nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten keimfähig sein. Die ältesten nachgewiesen keimfähigen Samen sind Samen der Lotusblume, die in einem ausgetrockneten Flußbett in China gefunden wurden. Nach 14C-Datierung waren sie 1450 Jahre alt (BROWN 2001). Teil der Fortpflanzungsstrategie vieler Pflanzen ist es, nicht bei der nächsten Gelegenheit zu keimen, sondern lange, eventuell Jahre im Boden zu überdauern, bis bestimmte äußere Reize die Keimung bei passenden Bedingungen auslösen. Solche Reize können ein Waldbrand oder ein Regenfall sein.
BROWN (2001) berichtet von einem seit 122 Jahren laufenden Experiment zur Keimfähigkeit von Pflanzensamen, das weltweit älteste dieser Art: Im Jahre 1879 füllte der Botaniker William J. BEAL von der heutigen Universität von Michigan Samen von 20 verschiedenen lokalen Pflanzenarten in feuchten Sand in Glasflaschen, versiegelte diese und vergrub sie im Boden des örtlichen botanischen Gartens. Zuerst alle fünf, dann alle zehn und seit 1980 alle 20 Jahre wird eine Flasche geöffnet und die enthaltenen Samen durch Wärme und Licht zum Keimen zu bringen versucht. Ber der letzten Öffnung einer Flasche im Jahre 2000 keimten 24 Samen aus. Außer zweien gehörten alle zu der Art Verbascum blattaria (Königskerze), die beiden anderen waren ebenfalls Verbascum-Arten. Mittels Einsatz einer Kältekammer konnte noch eine Malven-Art (Malva neglecta) zum Keimen gebracht werden. Bei der vorletzten Öffnung 1980 hatten exakt dieselben Arten gekeimt. Das Nichtkeimen der anderen Arten könnte wenigstens teilweise darauf zurückzuführen sein, daß die Öffnung der Flaschen nicht zum jahreszeitlich artspezifischen Optimum erfolgt.
Die Ergebnisse belegen, daß es grundsätzlich möglich ist, daß Pflanzensamen unter Benetzung viele Jahre keimfähig bleiben – eine Fähigkeit, die bei längerfristigen Überflutungen sehr nützlich ist.
[BROWN K (2001) Patience yields secrets of seed longevity, Science 291, 1884-1885.]
WL
|

|
Ein möglicherweise knapp 1 Millionen radiometrische Jahre alter Schädel (Sm3) von Sambungmacan (Java) zeigt eine Mischung aus Merkmalen, die bei bisher nur bei phylogenetisch und zeitlich weit auseinanderliegenden menschlichen Formen bekannt waren. Er besitzt mittelmäßig kräftige Überaugenwülste wie Homo erectus und ein erectus-ähnliches Gehirnvolumen, während ihm einige der für erectus typischen und diagnostisch wichtigen Merkmale fehlen (z.B. die Rinne hinter dem Überaugenwulst). Dagegen besitzt er eine höhere und vertikalere Stirn, einen runderen aufgewölbten Schädel und ein weniger stark geknicktes Hinterhaupt, was untypisch für Homo erectus ist, und eher vergleichbar mit dem nach Evolutionsvorstellungen sehr viel später lebenden Homo sapiens. In vielen anderen Merkmalen ist er intermediär zwischen Homo erectus- und späteren archaischen und modernen Homo sapiens-Formen.
Auch sein Gehirn erscheint erstaunlich weit fortgeschritten, unter anderem sichtbar in einer stark ausgeprägten Assymetrie der Broca’schen Kappe. Der Stirnlappen ist viel runder und kürzer im Vergleich zum flachen und verlängerten Stirnlappen aller anderen Javanesichen Homo erectus-Formen. Ungewöhnlich ist zudem, wie weit hinten die Fläche mit der größten Gehirnbreite liegt. Dieser ungewöhnliche Schädel wurde schon 1977 gefunden und hat nach seiner Entdeckung eine Odyssee (illegale Grabung, 1998 Entfernung aus Indonesien und 1999 Wiederentdeckung in einem Naturhistorischen Vertrieb) hinter sich.
Zwei Artikel, die sich mit dem Fund befassen, enden mit bemerkenswerten Schlußfolgerungen: „Auch wenn die auffallend modern anmutenden Merkmale ... nicht unbedingt auf eine bestimmte Vorfahrenschaft hinweisen muß [gemeint ist ein sapiens-ähnlicher Vorfahre, Anm.], müssen wir dennoch eine neue Dimension in der außerordentlichen Variabilität der indonesischen Homo erectus anerkennen“ (BROADFIELD et al. 2001). „Es ist noch nicht möglich festzustellen, ob diese Ähnlichkeit [mit sapiens, Anm.] eine evolutionäre Verwandtschaft nahelegt oder – was wahrscheinlicher ist – individuelle oder lokale Populations-Variabilität darstellt“ (DELSON et al. (2001).
Ein sapiens-ähnlicher Vorfahre ist evolutionstheoretisch natürlich nicht diskutabel, da H. sapiens nach dieser Sicht erst viel später entstand. Interessant sind daher die Versuche, die sapiens-Merkmale als Variabilität zu verstehen: dies entspricht ziemlich genau der Erklärung des Grundtypmodells: der polyvalente Typus Homo entfaltet an unterschiedlichen Orten und Zeiten seine morphologische Vielfalt, manchmal auf unerwartete Weise. Man geht nicht von linear sich verändernden Morphologien aus, sondern erwartet radiärsymmetrische und auch sprunghafte Veränderung des Grundtyps Mensch in Raum und Zeit.
[BROADFIELD DC, HOLLOWAY RL, et al. (2001. Endocast of Sambungmacan 3 (Sm 3): a new Homo erectus from Indonesia. Anat Rec 262, 369-379; DELSON E, HARVATI K, et al. (2001) The Sambungmacan 3 Homo erectus calvaria: a comparative morphometric and morphological analysis. Anat. Rec. 262, 380-397; MARQUEZ S, MOWBRAY K, et al. (2001) New fossil hominid calvaria from Indonesia—Sambungmacan 3. Anat. Rec. 262, 344-368.]
SHS
|

|
Das Erzgebirge ist geologisch gesehen Teil der Böhmischen Masse. In präkambrisches und paläozoisches Grundgebirge sind im Karbon und frühen Perm Granite intrudiert. Seit längerem ist bekannt, daß der Wärmefluß in den Graniten selbst im weltweiten Vergleich besonders hoch ist. Als Ursache wurden u. a. ein hoher Wärmefluß aus dem Erdmantel oder tiefreichende Zirkulation von Fluiden angenommen.
In einer jüngeren Untersuchung wurden der Wärmefluß und seine mögliche Herkunft aus dem Mantel erneut diskutiert. Hierzu wurden Daten aus früheren Bohrungen ausgewertet, um die Temperaturgradienten zu bestimmen. Zwar sind die Meßwerte nur bedingt tauglich, da diese Bohrungen einst der Erkundung von Erzlagerstätten dienten, doch läßt die große Zahl an Bohrungen innerhalb gewisser Fehlergrenzen eine entsprechende Analyse zu.
Aus dem Wärmefluß, dem Gehalt an wärmeproduzierenden Elementen, seismischen und gravimetrischen Daten lassen sich Modelle über den Aufbau der nicht mehr durch Bohrungen zugänglichen Erdkruste entwickeln. Für das Erzgebirge folgt daraus, daß ein extrem hoher Wärmefluß aus dem Erdmantel oder zirkulierende Lösungen den an der Erdoberfläche ermittelten hohen Wärmefluß nicht erklären können.
Vielmehr sind die erhöhten Werte in den Gesteinen auf den hohen Gehalt an radioaktiven Elementen, vor allem von Uran und Thorium zurückzuführen. Während in den benachbarten metamorphen Gesteinen Uran und Thorium etwa in gleichen Teilen vorkommen, enthalten die Granite hauptsächlich Uran als wärmeproduzierendes Element. Allerdings sind die Uran-Gehalte nahe der Erdoberfläche, wo das Gestein der Verwitterung ausgesetzt war, um das 2- bis 5-fache geringer.
Detaillierte Untersuchungen wie die im Erzgebirge machen deutlich, wie stark der Wärmefluß von lokalen Faktoren und besonders vom Gehalt an radioaktivem Material abhängt. Da der Beitrag der Erdkruste zum gesamten Wärmefluß im Erzgebirge 70-80% ausmachen kann, stellt sich die Frage, wie sicher verallgemeinernde Aussagen über den Wärmefluß aus dem Erdmantel überhaupt sind. Zwar lassen sich hierzu gerade mit Hilfe der Meßdaten aus den genannten Bohrungen plausible Vorstellungen entwickeln. Wenn aber der größte Teil des thermischen Signals aus den oberen 10-15 km der Erdkruste stammt, bleibt vieles über die thermische Entwicklung des Erdmantels im Ungewissen.
[FÖRSTER A & FÖRSTER HJ (2000) Crustal composition and mantle heat flow: Implications from surface heat flow and radiogenic heat production in the Variscan Erzgebirge (Germany). J. Geophys. Res. 105, 27917-27938.]
TF
|

|
Der Name „Palästina“ ist eine Abkürzung von „Palaistinae Syria“, was in der Spätantike „Syrien der Philister“ bedeutete. Der römische Kaiser Hadrian hatte Judäa nach der Niederschlagung des Bar-Kochba-Aufstandes so umbenannt. Philologisch wird Palästina im Anschluß an den spätjüdischen Geschichtsschreiber Josephus auf „Peleschet“, der Bezeichnung für die Philister im hebräischen Alten Testament zurückgeführt. Soweit die konventionelle Sichtweise.
David JACOBSON von der Universität London stellt dem seit kurzem eine alternative Erklärung entgegen, die er sowohl auf historisch-geographische als auch auf philologische Argumente stützt. Zunächst fällt auf, daß die antiken Geographen und Geschichtsschreiber Herodot, Aristoteles, Philo von Alexandrien u.a.m. die Bezeichnung auf das ganze Gebiet des heutigen Israel anwendeten und nicht nur auf den Küstenstreifen, den die Philister bewohnten, bevor sich ihre geschichtliche Spur im späten siebten Jahrhundert v.Chr. verliert. Dabei darf man den alten Gelehrten einiges an Detailkenntnis zugestehen. So weiß beispielsweise Herodot, der in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts v.Chr. schrieb, von der Vernichtung des assyrischen Heeres König Sanheribs durch göttliches Eingreifen, wohl eine Bezugnahme auf die in 2. Könige 19, 35-36 geschilderten Ereignisse im Zusammenhang mit der vergeblichen Belagerung Jerusalems zweieinhalb Jahrhunderte zuvor. Die Ausdehnung des Landes Palästina entsprach für ihn dem Siedlungsraum des beschnittenen Volkes. Die Philister waren jedoch eindeutig nicht beschnitten.
Bezog sich der Name Palästina aber auf Israel und nicht auf das Gebiet der Philister, wie ist dann die erwähnte klangliche Ähnlichkeit zu erklären? JACOBSON wartet hier mit einer verblüffenden Erklärung auf. Das griechische „Palestine“ weist eine starke Ähnlichkeit mit „palaistes“, dem griechischen Wort für „Ringkämpfer“, „Rivale“ oder auch „Gegenspieler“ auf. Dies entspricht aber genau der ursprünglichen Bedeutung des Namens Israel, den Gott dem Stammvater Jakob am Jabbok verliehen hatte: „Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel (Kämpfer Gottes), denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft (gerungen: sarita) und warst überlegen.“ (1. Mose 32,29). Auf die antiken Griechen, deren Begeisterung für den Ringkampf in ihren Erzählungen und auf zahllosen bildlichen Darstellungen bezeugt ist, sollte ein solcher Bericht eine ungeheure Wirkung gehabt haben. Daß sie Namen ihrem Sinn nach übersetzten und nicht einfach transkribierten, ist in vielen Fällen belegt. Die Begriffe „palaistes“ und „Palestine“ sind sehr viel näher beieinander als „Peleschet“ und „Palestine“. Es fällt zudem auf, daß die Übersetzer des griechischen Alten Testaments, der Septuaginta, die Philister (hebr. Peleschet) nicht mit „Palestinoi“ wiedergegeben haben, obwohl ihnen dieser Begriff, den auch Herodot gebraucht hat, zur Verfügung gestanden haben muß. Statt dessen transkribieren sie als „Philistieim“ (wörtl. „Land der Philister“). Angesichts der griechischen Vorliebe für Wortspiele hält es JACOBSON für möglich, daß „Palestine“ sowohl für Israel als auch für Philistäa in Gebrauch gewesen sein könnte.
[JACOBSON D (2001) When Palestine meant Israel. Biblical Archaeological Review 27, 43-47.57]
UZ
|
|  |
