 |
|
|  |
|
Die Mehrzahl der Ordnungen der heutigen Vögel gehört zu den sogenannten Neoaves. Deren Verwandtschaftsverhältnisse zu ermitteln, hat sich als ausgesprochen schwierig erwiesen. In seiner vielzitierten „Geschichte der biologischen Gedankenwelt“ schrieb der unlängst verstorbene berühmte Ornithologe und Evolutionsbiologe Ernst Mayr: „Die meisten Nicht-Taxonomen sind erstaunt, wenn sie hören, wie wenig sicher unsere Kenntnis der Verwandtschaftsgrade der Organismen immer noch ist. Zum Beispiel wissen wir bei der Mehrheit der Vogelordnungen immer noch nicht, welche andere Ordnung jeweils am nächsten mit ihr verwandt ist. Das gleiche gilt für viele Säugtierfamilien und -gattungen…“ (Mayr 1984, 175).
An dieser Situation hat sich in den letzten 20 Jahren offenbar nichts Wesentliches geändert. Jedenfalls finden Fain & Houde (2004) die Verwandtschaftsverhältnisse der Ordnungen der Neoaves „frustratingly vexing“ (irritierend, bedrückend, keine Ruhe lassend). Um einen Beitrag zur Klärung der Beziehungen zu leisten, untersuchten diese Autoren Intron 7 des b-Fibrinogen-Gens von Arten aus 150 Vogelfamilien. Das daraus abgeleitete Dendrogramm weist auf eine bisher nicht vermutete Trennung zweier Untergruppen der Neoaves hin, die die Autoren als Metaves und Coronaves bezeichnen. Bemerkenswert ist dabei, daß es in beiden Linien parallel zahlreiche Familien mit ähnlichen Merkmalen und ökologischen Anpassungen gibt. Fain & Houde bilden in Ihrer Veröffentlichung elf eindrückliche Beispiele solcher Konvergenzpaare ab. Einige dieser Konvergenzen waren früher schon vermutet worden (vgl. Weller 2003) und werden durch diese neuen DNA-Sequenzvergleiche bestätitigt; neue Fälle kommen dazu. Überraschenderweise legen die Studien aber auch nahe, daß manche Ordnungen selbst polyphyletisch sind, da sie Familien umfassen, die zu den beiden verschiedenen Linien gehören. Das heißt: Diese Ordnungen besitzen entgegen bisheriger Auffassungen keine gemeinsame Vorfahren.
Die Studie von Fain & Houde unterstreicht zweierlei: 1. Konvergenzen sind verbreitet, somit sind morphologische Gemeinsamkeiten keine Garantie für Abstammungsgemeinschaft. 2. Morphologische und molekulare Ähnlichkeiten sind oft nicht deckungsgleich. In populären Darstellungen zur Evolutionstheorie wird dagegen oft eine Kongruenz behauptet und als beeindruckende Bestätigung für eine allgemeine Evolution der Lebewesen gewertet. Dies entspricht in vielen Fällen bei weitem nicht den Tatsachen.
[Fain MG & Houde P (2004) Parallel radiations in the primary clades of birds. Evolution 58, 2558-2773; Mayr E (1984) Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt, Heidelberg; Weller A (2003) Merkmalsmosaike bei Wasservögeln. Stud. Int. J. 10, 36-38.]
|

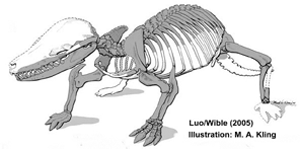 |
| Abb.1: Rekonstruktion von Fruitafossor windscheffeli (Holotype: LACM 150948) als grabendes Säugetier. Die schattierten Teile sind fossil erhalten. (Aus Luo & Wible 2005, Abdruck mit freundlicher Genehmigung) |
|
An heutige termitenfressende Gürteltiere und Erdferkel erinnert ein Säugerfossil aus dem Oberjura (der Zeit, aus der man den berühmten Urvogel Archaeopteryx kennt). Es lag längere Zeit unbeachtet im Archiv eines Museums, bis vor kurzem seine Bedeutung erkannt wurde. Merkmale des Gebisses sowie die Grabbeine weisen bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den heutigen Termitenfressern auf. Fruitafossor windscheffeli (Abb. 1), der nach dem Entdecker Wally Windscheffel benannte „Gräber von Fruita“ (Stadt in Colorado) ist jedoch in viel älteren Schichten gefunden worden als alle Gürteltier- und Erdferkelverwandten, die ab dem Eozän (50 Milionen Jahre) bekannt sind. Da andere Merkmale gegen eine nähere Verwandtschaft sprechen, muß eine unabhängige Entstehung der speziellen Merkmale angenommen werden (Konvergenz). Fruitafossor ist ein weiteres Beispiel eines ursprünglichen Säugetiers mit sehr spezialisierten Merkmalen. Es besitzt zudem auch einzigartige Merkmale im Unterkieferbereich. Ebenso wie andere frühe Säuger weist dieses Fossil keine durchgängige „Primitivität“ auf (vgl. Junker & Scherer 2001, 230f.).
[Junker R & Scherer S (2001) Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Gießen; Luo ZX & Wible JR (2005) A late Jurassic digging mammal and early mammalian diversification. Science 308, 103-107.] |

|
Unter den Paläontologen gibt es seit langen eine Kontroverse darüber, ob sich die heute vorkommenden Vogelordnungen erst nach dem Aussterben der letzten Dinsoaurier an der Kreide/Tertiär-Grenze entwickelten oder mindestens teilweise schon vorher mit den Dinos koexistierten. Molekulare und biogeographische Daten deuteten bisher bereits darauf hin, daß letzteres der Fall ist, doch der Fossilbefund sprach eher für ein spätes Auftreten der heutigen Vogelgruppen; demnach könnte das Aussterben der Dinosaurier das Auftreten der Vögel begünstigt haben. Ein Fossilfund aus der Oberkreide belegt nun jedoch erstmals die Existenz enger Verwandter heutiger Vögel zur Zeit der Dinosaurier. Vegavis iaai, so der Name der neuen Vorgelart, wird zur Ordnung der Anseriformes gerechnet, zu welcher auch die Entenartigen gehören (das Fossil unterscheidet sich aber von heutigen Angehörigen dieser Ordnung). Aufgrund von Merkmalsvergleichen ergibt sich unter evolutionstheoretischen Voraussetzungen für Vegavis eine Stammbaumposition, die fünf Gabelungen unter den heutigen Vogelgruppen bereits vor der Kreide-Tertiär-Grenze erfordert. Daraus kann geschlossen werden, daß ein Großteil der Vogelordnungen vor dieser Grenze gelebt hat. Dafür wiederum fehlen bislang allerdings fossile Belege. Haben die Vögel damals vielleicht in geologisch nicht überlieferten Lebensräumen gelebt?
[Clarke JA, Tambussi CP, Noriega JI, Erickson GM & Ketcham RA (2005) Definitive fossil evidence for the extant radiation in the Cretaceous. Nature 433, 305-308.]
|

 |
| Abb.1: Würfelqualle Tripedalia cystophora. © 2005 Monterey Bay Aquarium Foundation. (Abdruck mit freundlicher Genehmigung) |
|
Quallen gehören zu den Organismen, die weit unten im Stammbaum des Lebens angesiedelt werden. Als „primitive“ Tiere sollten sie auch primitive Organe haben, könnte man meinen. Daß dem nicht so ist, beweist Tripedalia cystophora (Abb. 1), eine nur ein Zentimeter große Würfelqualle aus dem Stamm der Nesseltiere (Cnidaria), die in tropischen Meeren lebt. Denn dieses filigrane Geschöpf besitzt entgegen aller Erwartungen Linsenauen, die es mit den Wirbeltieraugen aufnehmen können, wie kürzlich Dan Nilsson und seine Kollegen von der schwedischen Universität Lund entdeckt haben.
 |
| Abb.2: Die Augen von Tripedalia cystophora: Obere und untere Linse, flankiert von zwei Paaren einfacherer Augen. Balken: 0,1 mm. (Aus Nilsson et al. 2005; Abdruck mit freundlicher Genehmigung) |
|
An den Ecken des würfelförmigen Körpers befinden sich vier Sinneskörper, sog. Rhopalien (Abb. 2). Jeder hat sechs Augen, vier einfache Pigmentbecheraugen sowie zwei weitere, die sich nun als echte Linsenaugen herausgestellt haben. Sie sind zwar nur Bruchteile eines Millimeters groß, dennoch aber Linsenaugen von Fischen sehr ähnlich. Eines der beiden besitzt sogar eine Pupille, die in weniger als einer Minute auf wechselnde Lichtverhältnisse reagiert. Ebenso erstaunlich ist, daß der Brechungsindex der Linsen kontinuierlich von innen nach außen leicht absinkt, wodurch ihr Abbildungsfehler korrigiert wird. Damit sollten scharfe Bilder möglich sein; doch seltsamerweise liegt die Brennweite hinter der Netzhaut, so daß dennoch nur ein unscharfes Bild erzeugt werden kann. Das Rätsel wird noch größer, wenn man bedenkt, daß die Tiere kein Zentralnervensystem, sondern nur einfache Nervenstränge besitzen. Daher ist unklar, wie sie die einkommenden Daten überhaupt verarbeiten. Wozu also der Aufwand mit Linse und Pupille? Hier scheint es noch eine Nuß zu knacken zu geben. Die Forscher vermuten, daß die unterfokussierten Augen quasi als Tiefpaßfilter die Wahrnehmung großer Objekte ermöglichen, während kleine Partikel unsichtbar bleiben. Doch das dürfte kaum die vollständige Antwort sein. In jedem Fall handelt es sich um ein weiteres erstaunliches Beispiel einer Konvergenz, hier zwischen Wirbeltier- und Quallenauge: „In fast jeder Hinsicht ähneln diese Linsenaugen denen von Tieren wie Fischen und Tintenfischen“, kommentiert Wehner (2005). Dennoch ist diese weitgehende Ähnlichkeit nicht auf gemeinsame Vorfahren zurückführbar.
[Wehner R (2005) Brainless eyes. Nature 435, 157-158; Nilsson D-E, Gislén L, Coates MM, Skogh C & Garm A (2005) Advanced optics in a jellyfish eye. Nature 435, 201-205.]
|

 |
| Abb.1: Nephila (Foto: Daniel Israelsson) |
|
Radnetzwebende Spinnen können die mechanischen Eigenschaften ihrer seidenen Fangnetze gezielt beeinflussen. Erhöht man künstlich das Gewicht von Spinnen, so erhöhen sie die Dicke ihrer Radialfäden. Auch die Spinngeschwindigkeit hat einen Einfluß. Je schneller der Faden gesponnen wird, um so gleichmäßer lagern sich die inneren Mikrostrukturen parallel zur Faser und erhöhen so die Festigkeit des Fadens. Eine neue Studie ergab, daß tropische Spinnen der Gattung Nephila (Abb. 1) sogar die chemische Komposition ihrer Seide beeinflussen können. Diese fingerlangen Spinnen weben große Radnetze von ca. einem Quadratmeter im Unterholz und fangen die verschiedensten Insekten. Je nach Standort unterschieden sich die Fasern der Netze in ihrer Zusammensetzung. Möglich wäre, daß die Spinnenpopulationen genetisch nicht einheitlich sind. Jedoch sind die Jungspinnen sehr mobil, denn sie lassen sich an langen Spinnenfäden mit dem Wind an neue Orte treiben, und andere Studien ergaben keine genetischen Unterschiede der Populationen. Erst Laborversuche offenbarten, daß diese Spinnen ihre Seide an das Beutespektrum anpassen können. Mit Fliegen gefütterte Spinnen verwendeten mehr Prolin- und Glutamin-, aber weniger Alanin-Bausteine als die mit Grillen gefütterten. Die veränderten Aminosäure-Verhältnisse ändern die molekulare Feinstruktur der Fäden. Fliegen müssen daran gehindert werden, das Netz mit hoher Geschwindigkeit zu durchbrechen, daher sind die Fäden besonders reißfest. Grillen reißen durch ihr Gewicht eher Löcher ins Netz, verstricken sich dann aber in mehr und mehr Fäden, entsprechend sind die Fäden besonders dehnbar. Der Auslöser für diese Umstellung in der chemischen Zusammensetzung der Fäden ist völlig offen.
[Tso I-M, Wu H-C & Hwang I-R (2005) Giant wood spider Nephila pilipes alters silk protein in response to prey variation. J. Exp. Biol. 208, 1053-1061.]
|

 |
| Abb.1: Die Struktur des Schwamms Euplectella entspricht im Detail grundlegenden mechanischen Bauprinzipien, die bei großen Gebäuden angewendet werden. (Lucent Technologies/Bell Labs) |
|
Wer hätte gedacht, daß ausgerechnet ein Lebewesen der Tiefsee Bauingenieuren und Werkstoffspezialisten Anschauungsunterricht in Sachen Statik, Tragwerksbau und Glasfasertechnik erteilt? Seit einigen Jahren werden Gießkannenschwämme der Gattung Euplectella (Abb. 1) von Wissenschaftlern der Bell-Laboratories in Murray Hill (New Jersey), der University of California in Santa Barbara und vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam eingehend untersucht. Der Grund dafür ist das außergewöhnliche Skelett von Euplectella aspergillum, ein Schwamm, der hauptsächlich im Westpazifik in Tiefen bis zu 5000 Metern lebt. Elsa Reichmanis, Leiterin der Materialforschung bei den Bell-Labs bemerkt fasziniert: „Diese Schwämme sind perfekt geformt und besitzen exakt die richtige Menge an Material für eine optimale Konstruktion.“ Entdeckt wurden zunächst haarfeine „Bio-Glasfasern“, die in drei hierarchischen Ebenen aufgebaut sind. So entsteht ein mit organischem Kleber verbundenes Mikrolaminat aus Silikat-Nanopartikeln, einer Lamellenstruktur und konzentrisch angeordneten Glasschichten von wenigen Mikrometern Dicke. Diese Fasern wurden als hervorragende, bruchsichere Lichtleiter erkannt, die dazu beitrugen, die kommerzielle Herstellung von Glasfasern zu verbessern. Doch damit nicht genug! Weitere vier Ebenen strukturellen Aufbaus mit jeweils unterschiedlichen mechanischen Konstruktionsprinzipien ergeben einen nahezu unzerbrechlichen, mehrere Dezimeter langen Kolben in Form eines netzartigen Fachwerks. Das Besondere dabei ist der hierarchische Aufbau über insgesamt sieben Ebenen verschiedener Größenordnungen vom Nanometer bis zum Zentimeter! Dabei wird die Sprödigkeit des Silikatglases durch den Faseraufbau optimal kompensiert und die „Fachwerkkonstruktion“ sorgt mit ihren diagonalen Streben für ausreichende Versteifung gegenüber ansetzenden Scherkräften. Eine zusätzliche Spiralstruktur verhindert das Zusammendrücken der Gesamt-Konstruktion. Beeindruckende Bilder von den Details dieser Konstruktion bietet die Arbeit von Aizenberg et al. (2005). Selbst wenn einige berühmte Bauwerke wie Eiffelturm, Swiss Re Tower in London u.a. bereits mehrere hierarchische Konstruktionsebenen aufweisen, sind sie doch im Vergleich mit dem Euplectella-Skelett einfach.
Im Bereich der Bionik werden permanent neue, erstaunliche Konstruktionen bei Lebewesen entdeckt und ihre Bedeutung für die Technik erkannt. In diesem Fall zeigt selbst ein scheinbar simpler Schwamm, daß Ingenieure noch jede Menge dazulernen können. Wenn es gelingt, Werkstoffe und Tragwerke nach dem Bauprinzip des Tiefseeschwammes zu optimieren, ist zu erwarten, daß zukünftige Bauwerke mit zusätzlicher Material- und Energieersparnis erstellt werden können, ohne daß ihre Stabilität darunter leidet. Mit jeder dieser erstaunlichen Entdeckungen stellt sich die Frage nach dem Konstrukteur dieser Lebewesen mit größerer Dringlichkeit.
Eine Präsentation dieser Arbeit in Spiegel-online schließt mit der Feststellung: „Sein vielleicht wichtigstes Geheimnis hat der Tiefseeschwamm allerdings nicht preisgegeben: wie es einem doch recht primitiven Organismus gelingt, eine derart komplexe Konstruktion überhaupt zu erschaffen.“ Ein erster Schritt zur Bearbeitung solcher Fragen könnte darin bestehen, mit dem Adjektiv „primitiv“ sparsamer umzugehen.
[Aizenberg J, Weaver JC, Thanawala MS, Sundar VC, Morse DE & Fratzl P (2005) Skeleton of Euplectella sp.: Structural Hierarchy from the Nanoscale to the Macroscale. Science 309, 275-278; http://www.spiegel.de/wissenschaft/erde/ 0,1518,druck-364617,00.html]
|

|
Der Austausch von genetischem Material (Rekombination) während der Meiose ist für diploide Organismen ein sehr wichtiger Vorgang. Dadurch werden immer wieder neue Allelkombinationen erzeugt (Allele sind verschiedene Zustandsformen derselben Gene). Dies wiederum bietet Potential für Anpassungsmöglichkeiten an wechselnde Umweltbedingungen. Die Rekombinationshäufigkeiten schwanken deutlich von Region zu Region auf den Chromosomen, die stark betroffenen Regionen werden als „hotspots“ bezeichnet. Winckler et al. (2005) führten eine vergleichende Studie zu den Rekombinationshäufigkeiten bei Schimpansen und Menschen durch und erhielten dabei ein überraschendes Ergebnis: Obwohl Mensch und Schimpanse auf der Ebene der DNA-Sequenzen zu etwa 99% identisch sind, treten die Hotspots der Rekombinationen selten, wenn überhaupt, an denselben Positionen auf (vgl. auch den Kommentar von Jorde 2005). Die Hotspots überlappen fast überhaupt nicht. Winckler et al. (2005) schließen daraus auf eine schnelle Evolution der Veränderung der Hotspot-Regionen. Diese Schlußfolgerung ergibt sich jedoch offensichtlich nicht aus den Daten, sondern aus der vorausgesetzten Stammesgeschichte. Oft werden die Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Menschenaffen besonders hervorgehoben. Das Beispiel der kaum überlappenden Rekombinationsorte stellt dagegen einen sehr markanten Unterschied dar. Ob dieser im Rahmen etablierter Vorstellungen plausibel gemacht werden kann, muß in weiteren Untersuchungen gezeigt werden. Möglicherweise entdeckt man dabei aber auch noch weitere Unterschiede.
[Jorde LB (2005) Where We’re Hot, They’re not. Science 308, 60-62; Winckler W, Myers SR, Richter DJ, Onofrio RC, McDonald GJ, Bontrop RE, McVean GAT, Gabriel SB, Reich D, Donnelly P & Altshuler D (2005) Comparison of Fine-Scale Recombination Rates in Humans and Chimpanzees. Science 308, 107-111.]
|

|
In einer Rezension des Buches „Doctor Doolittle‘s Delusion: Animals and the Uniqueness of Human Language“ (von Stephen R. Anderson) hebt der Rezensent Neil Smith, ein Londoner Linguistiker, die qualitative Einzigartigkeit der menschlichen Sprache gegenüber allen bekannten tierischen Kommunikationsformen hervor. Auch die Kommunikationssysteme der Primaten seien der menschlichen Sprache weniger ähnlich als allgemein angenommen werde. So ist der Gebrauch einer Syntax ein komplettes Novum. Das heißt: Die Art und Weise, wie wir Wörter kombinieren, um einen bedeutungsvollen Satz zu formulieren, ist exklusiv menschlich. Darüber hinaus ist der menschliche Wortschatz „dramatisch größer“ als die begrifflichen Möglichkeiten von Tieren, ebenso sind unsere Lautsysteme komplexer. Anderson zieht die bemerkenswerte Schlußfolgerung, daß so wie der Tanz der Bienen, der Gesang der Vögel und die Rufe der Affen einzigartig für die jeweiligen Arten sind, so ist es die menschliche Sprache für uns. Es scheint, als würde die Evolution der Kommunikationssysteme evolutionär desto weniger verstanden, je deutlicher ihre Einzigartigkeit aufgrund der Forschung hervortritt.
[Smith N (2005) Don‘t talk to the animals. Nature 434, 702-703.]
|

|
Einschläge großer kosmischer Körper (Asteroiden und Kometen) gelten als extremste kurzzeitige Katastrophen, denen die Biosphäre ausgesetzt sein kann. Viele Details werden zwar weiter diskutiert, aber insgesamt herrscht Konsens darüber, daß an der Kreide/Tertiär-Grenze ein großes Massenaussterben stattfand (vgl. Jäger 1997, 363-365). Nach Moosbrugger (2003, 149) ist dieses Aussterben zwar nicht das größte, aber das spektakulärste. Denn erstens nimmt man an, daß ihm so bekannte und beliebte Tiergruppen wie Dinosaurier und Ammoniten endgültig zum Opfer fielen, und zweitens spricht vieles dafür, daß diesem Massenaussterben eine Einschlagstruktur zugeordnet werden muß, der Chicxulub-Krater in Nordost-Mexiko (Yucatán-Halbinsel). Daneben diskutiert man den zeitgleichen, aber länger dauernden enormen Deccan-Plateauvulkanismus (Indien) als Haupt- oder Mitverdächtigen für das Aussterben; doch werden noch weitere mögliche Ursachen erörtert (zusammenfassende Überblicke z.B. bei Jäger 1997-2003; Mosbrugger 2003).
Es wird angenommen, daß sich durch aufgewirbelte Staubmassen, Aschenpartikel und Aerosole (s.u.) ein dichter Staubschleier in der Atmosphäre bildete. Dadurch wurde die Sonneneinstrahlung stark eingeschränkt, und es kam zu plötzlicher, massiver Abkühlung (Jäger 2003, 44). Ein entsprechendes Kältesturz-Szenario wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts während des Ost-West-Konflikts für den Fall eines Atomkrieges entworfen und als „nuklearer Winter“ bezeichnet (Moosbrugger 2003, 150).
Wie unsicher jedoch die Annahme derart extremer klimatischer Veränderungen an der Kreide/ Tertiär-Grenze ist, zeigt beispielhaft der folgende Befund. Er wurde auf der Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft der USA im Herbst 2004 von der Paläontologin J.M. Kozisek (Universität New Orleans) vorgestellt. Die in Bernstein vorkommende, pollensammelnde Honigbiene Cretotrigona prisca tritt sowohl unterhalb als auch oberhalb der Kreide/Tertiär-Grenze auf. Sie läßt sich von modernen tropischen Bienen kaum unterscheiden. Deshalb schließt Kozisek auf gleiche Lebensbedingungen und Klimaansprüche. Danach sollten die Temperaturen zwischen 31 und 34 °C betragen, und die Temperaturschwankungen 2 bis 7 °C nicht überschritten haben.
Das widerspricht aber dem Szenario vom jahrzehntelangen „nuklearen Winter“; man nimmt heute an, daß dabei die Temperaturen global um ca. 7 bis 12 °C gefallen seien. Dies ist nach Kozisek eindeutig zu kalt für tropische Honigbienen; weder sie, noch die Pflanzen, von denen sie täglich Pollen verzehrten, hätten einen derartigen Temperatursturz überstehen können (GSA Release 04-32, 2004). Auch Lessem (1994, 264f.) berichtete über Daten, die mit dem „Bienen-Befund“ kompatibel sind, z.B. fehlende Hinweise auf Frostschädigungen bei Pflanzen sowie wärmeliebende Pflanzen über der Kreide/Tertiär-Grenze.
Jäger (2003, 44) meint, der Ruß- und Staubschleier sei „an manchen Stellen“ weniger dicht gewesen, „mancherorts konnten vielleicht sogar schon kurz nach dem Impakt Farne gedeihen“. Allerdings geht dieser Autor von folgendem Szenario aus: Durch das im Einschlagkrater zerstörte Anhydrit-Gestein (Calciumsulfat; ein Salz der Schwefelsäure mit etwas gebundenem Wasser) entstanden große Mengen winziger Schwefelsäure-Tröpfchen. Diese hätten nach dem Impakt als ca. 8-10 Jahre in der Stratosphäre bleibende Aerosolwolken etwa 80-90% des Sonnenlichts abgeschirmt. Erst danach sei es zu einer langfristigen Erwärmung gekommen. Denn beim Einschlag waren durch Zerstörung der im Krater-Areal überwiegend anstehenden Karbonatgesteine enorme Mengen Kohlendioxid freigesetzt worden; dessen Wirkung setzte mit dem Verschwinden der Aerosolwolken ein. Auch der Deccan-Vulkanismus produzierte viel CO2; insgesamt kam es dadurch zu einem Treibhaus-Effekt (dessen Stärke umstritten ist; Jäger 2003, 44f.; vgl. 1998, 186; 1999, 305f.).
Dieses Klimawechsel-Szenario (erst kalt, dann warm) ist jedoch mit den Daten von Kozisek nicht kompatibel. Denn danach mußte es trotz Impakt warm bleiben, und es mußten tropische Blütenpflanzen weiterhin gedeihen, von deren Pollen Cretotrigona prisca sich ernährte.
Fazit: Die Folgen des Kreide/Tertiär-Impakts scheinen nicht so gravierend gewesen sein, wie es zumeist dargestellt wird. Und: Es ist bemerkenswert, daß ein kleiner (Be)Fund wieder einmal ein großes Hypothesengebäude ins Wanken bringen kann.
[Honeybees Defy Dino-Killing „Nuclear Winter“, GSA Release No. 04-32, 5 November 2004, Geological Society of America, Internet: www.geosociety.org/news/pr/04-31.htm; Jäger M (1997/98/99/2003) Faunenschnitt – Was geschah am Ende der Kreidezeit? (Teil 1-5). Fossilien 14, 363-371; 15, 181-189; 16, 298-310.360-368; 20, 40-51; Lessem D (1994) Dinosaurierforscher. Basel etc: Birkhäuser; Moosbrugger V (2003) Das große Sterben vor 65 Millionen Jahren. In: Hansch W (Hg) Katastrophen in der Erdgeschichte. Museo 19, 144-153. Heilbronn]
|

Die Wissenschaft geht heute laut Lehrbuchwissen von einem Alter der Erde von ca. 4,6 x 109 Jahren aus. In einer ersten Phase war sie nach gängigen Vorstellungen aufgrund der thermischen Bedingungen steril und auch später war die Erdoberfläche aufgrund intensiven Meteoritenbombardements kein hospitabler Lebensraum.
Mojzsis und Mitarbeiter erregten mit Veröffentlichungen (Mojzsis et al. 1996, Nutman et al. 1997) Aufsehen, als sie behaupteten, in Sedimentgestein der kleinen Insel Akilia, an der Westküste von Grönland, indirekte Hinweise auf Leben gefunden zu haben. Das Besondere daran: Aufgrund radiometrischer Datierungen wird diesem Gestein ein Alter von 3,85 x 109 Jahren zugeordnet; damit gehört es zu den ältesten Sedimentsystemen auf der Erde. Die Behauptung, es handle sich um Lebensspuren bzw. es gebe indirekte Hinweise darauf, begründeten die Autoren mit der Verteilung von Kohlenstoffisotopen in winzigen Graphiteinschlüssen, die sie in Apatit (Calciumphosphat-Mineral) gefunden hatten. In einer jüngst erschienenen Publikation (Lepland et al. 2005) konnte das Vorkommen von Graphit in Apatit-Kristallen von Akilia allerdings nicht bestätigt werden; auch in den Originalproben nicht.
Mojzsis und Mitarbeiter hatten das Muttergestein, aus dem sie ihre Proben gewonnen hatten, als bebänderte Eisenformation (BIF, banded iron formation) beschrieben. BIFs werden als Meeressedimente interpretiert und bestehen aus wechselnden Lagen von Eisenoxid (Magnetit oder Hämatit) und Silikaten (Quarz). Andere Autoren (Fedo & Whitehouse 2002) geben für die dunklen Bänder stattdessen Eisenoxid mit Pyroxen (Aluminiumsilikate mit Calzium, Magnesium und Eisen) an und interpretieren sie als stark metamorph verändertes Gestein magmatischen Ursprungs (magmatisches Gestein wird in unmittelbarer Umgebung gefunden); in solchem Gestein sind Hinweise auf Lebensspuren nicht zu erwarten.
Die Altersangaben aufgrund der radiometrischen Datierung (U-Pb) an Zirkon werden von verschiedenen Arbeitsgruppen ebenfalls kontrovers diskutiert.
Auch andere sehr frühe fossile Hinweise auf Leben wie die von Schopf (1993) präsentierten Funde von Westaustralien, die mit einem Alter von 3,5 x 109 Jahren angegeben werden, wurden von Brasier et al. (2002) in Frage gestellt. Durch die Erwiderungen und die Präsentation neuer Daten von Schopf et al. (2002) bleibt die Diskussion im Gange, so daß auch populärwissenschaftliche Journale das Thema aufgreifen und die Diskussion einem breiteren Publikum vorstellen (Simpson 2004).
Es ist begrüßenswert, wenn gerade die frühesten fossilen Lebensspuren einer besonders kritischen Prüfung unterzogen werden, zumal dieses Thema von der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt wird. Für Moorpath (2005) sind Fossilien von Bakterien in der Guntflint Formation in Ontario mit 1,9 x 109 Jahren die frühesten heute allgemein akzeptierten Spuren von Leben.
[Brasier MD, Green OR, Jephcoat AP, Kleppe AK, van Kranendonk MJ, Lindsay JF, Steele A, Grassineau NV (2002) Questioning the evidence for earth’s oldest fossils. Nature 247, 76-81; Lepland A, van Zullen MA, Arrhenius G, Whitehouse MJ, Fredo CM (2005) Questioning the evidence for Earth´s earliest life – Akilia revisited. Geology 33, 77-79; Mojzsis SJ, Arrhenius G, McKeegan KD, Harrison TM, Nutman AP, Friend CR (1996) Evidence for life on earth before 3,800 million years ago. Nature 384, 55-59; Moorpath S (2005) Dating the earliest life. Nature 434, 155; Nutman AP, Mojzsis SJ, Friend CRL (1997) Recognition of 3.850 Ma water-lain sediments in West Greenland and their significance for the early Archean Earth. Geochim. Cosmochim. Acta 61, 2475-2485; Schopf JW (1993) Microfossils of the Early Archean Apex chert: New evidence of the antiquity of life. Science 260, 640-646; Schopf WJ, Kudryavtsev AB, Agresti DG, Wdowiak TU, Czaja AD (2002) Laser-Raman imagery of earth´s earliest fossils. Nature 416, 73-76; Simpson S (2004) Wie alt sind die ersten Lebensspuren? Spektrum der Wissenschaft 2004/4, 70-77; Technical Comments (2002), Science 298, 917a]
|

|
Aus dem jüngsten Präkambrium praktisch aller Erdteile kennt man inzwischen die sog. Ediacara-Lebewelt. Sie wurde nach den gleichnamigen Hügeln in Südaustralien benannt und unterscheidet sich von den späteren Formen der Lebewesen ab dem Kambrium. Im Interpretationsgebäude der Evolutionslehre war es gleichwohl naheliegend, unter ihnen Vorfahren der späteren Lebewesen zu suchen.
 |
| Abb.1: Bäumchenartig verzweigte Ediacara-Organismen aus der Dengying-Formation von Südchina. (Aus Xiao et al. 2005, Abdruck mit freundlicher Genehmigung) |
|
Eine völlig andere Deutung der Ediacara-Lebewesen hat der Spurenspezialist A. Seilacher (z.B. 1988; 1992) entwickelt. Er nennt sie „Vendobionten“ (nach der jüngstpräkambrischen Vendium-Stufe) und sieht in ihnen keine Vorläufer späterer Tierstämme, die ab dem Kambrium plötzlich in den Sedimenten auftreten (Stichwort „kambrische Explosion“; dazu zuletzt in diesem Journal Junker 2005). Vielmehr handle es sich um unabhängige, frühe Lebensformen, bevor im Kambrium Räuber auftraten (die sich aus wurm- bzw. schneckenartigen präkambrischen Vorfahren entwickelt hätten). „Die kambrische Explosion beendete diesen friedlichen ‚Garten von Ediacara’ und es begann das vielschichtige System des Fressens und Gefressenwerdens“ (Seilacher 2003, 79). Die Vendobionten sind nach Seilacher spezialisierte, große (z.T. mehr als 25 cm lang), einzellige, aber vielkernige Mikrobenhüllen, die wie „Pneus“ mit Zytoplasma gefüllt waren; sie stellten gewissermaßen „lebende Luftmatratzen“ dar und besitzen keine inneren Organe. Ihre Körperhülle war in sehr verschiedenartiger Weise mit Lamellen „abgesteppt“ und bildete so ein „hydraulisches Skelett“. Im und auf dem Sandboden bewegter Flachmeere waren sie durch Mikrobenfilme „festgeklebt“ und mit ihnen ökologisch vergesellschaftet; sie führten ein uns fremdartiges Leben unter ganz spezifischen Umweltbedingungen (vgl. Stephan 1994, 5f.).
Es ist verständlich, daß diese exotisch anmutende Deutung als „Rieseneinzeller“, für die Seilacher allerdings gute Gründe anführt, heftig diskutiert wurde (vgl. z.B. Geyer 1998, 9). In neueren Arbeiten betont er immerhin eine Beziehung zu bekannten Einzellern, nämlich heute lebenden (!) Tiefsee-Riesenforaminiferen (Xenophyophoren) wie Stannophyllum (Seilacher 2000, 554-556; Abbildungen im Internet: http://19thcenturyscience.org/HMSC/HMSC-Reports/Zool-82/htm/doc.html). Demnach wären nicht alle Vendobionten (bald) nach dem Präkambrium ausgestorben, sondern teilweise – wie andere „lebende Fossilien“! – in die Tiefsee abgewandert (Seilacher 2003, 72f., 81; vgl. z.B. Ziegler 1998, 270f.; Kleesattel 2001, 133-150).
In einer neuen Arbeit kommen chinesische Paläontologen (Xiao et al. 2005) zu ähnlichen Resultaten wie Seilacher (vgl. Jahn 2005). Im Gegensatz zu flachmarinen Sanden, in denen sonst Ediacara-Organismen eingebettet sind, handelt es sich in der südchinesischen Dengying-Formation um Karbonate. Besonders wichtig ist, dass hier die Überreste der Vendobionten wegen der außergewöhnlichen Erhaltung besonders gut erforscht werden können. Sie sind bäumchenartig verzweigt (Abb. 1) und haben im Kalkstein dreidimensionale Hohlformen hinterlassen, die mit Kalzit gefüllt sind; das läßt räumliche Untersuchungen zu. Xiao et al. (2005, 10228, 10231) weichen aber besonders in Folgendem von Seilachers Interpretation ab: Bei den abgesteppten „Pneus“ der Dengying-Formation sind die Kammern, die der zentralen Körperachse fern (distal) liegen, nach außen offen; diese könnten daher nicht mit Zytoplasma gefüllt gewesen sein.
Man kann gespannt sein, wie sich nun die Gewichte in der Forschung verschieben und die Vendobionten-Interpretation der rätselhaften Ediacara-Fossilien weiterentwickelt wird.
[Geyer G (1998) Die kambrische Explosion. Paläont. Z. 72, 7-30; Jahn A (2005) Alte Matratzen. Gut erhaltene Fossilien zeigen Baupläne der Ediacara-Fauna. spektrumdirekt. Internet: www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/783223 (13.07.05); Junker R (2005) Die kambrische Explosion – entschärft? Stud. Int. J. 12, 38-39; Kleesattel W (2001) Die Welt der lebenden Fossilien. Darmstadt: Wiss. Buchges.; Seilacher A (1982) Vendozoa: Organismic construction in the Proterozoic biosphere. Lethaia 22, 229-239; Seilacher A (1992) Vendobionta als Alternative zu den Vielzellern. Mitt. hamb. zool. Mus. Inst. 89, 9-20, Hamburg; Seilacher A (2000) Leben im Präkambrium. Naturwiss. Rdsch. 53, 553-558; Seilacher A (2003) Der Garten von Ediacara und die kambrische Explosion. In: Hansch W (Hg) Katastrophen in der Erdgschichte. Museo 19, 70-81. Heilbronn; Stephan M (1994) Neuere Forschungen zur Lebewelt im Kambrium und Präkambrium. Stud. Int. J. 1, 4-11; Xiao S, Shen B, Zhou C, Xie G & Yuan X (2005) A uniquely preserved Ediacaran fossil whit direct evidence for a quilted bodyplan. Proc. Nat. Acad. Sc. 102, 10227-10232; Ziegler B (1998) Spezielle Paläontologie, Teil 3. Stuttgart: Schweizerbart]
|

|
„Evolutionsmedizin, relativ junge Forschungsrichtung der Medizin, die Gesundheit und Krankheit systematisch unter evolutionsbiologischen Gesichtspunkten betrachtet“ – so das „Kompaktlexikon der Biologie“. Seit den 1990er Jahren wird diese neue Anwendung der Evolutionstheorie propagiert. Auch als „Darwinistische Medizin“ ordnet sie Krankheiten des Menschen „evolutionären Ursachen“ zu (Nesse & Williams 1997, 1999):
- „Abwehr- und Verteidigungsmechanismen“
- Veränderte Umweltbedingungen sind Ursache von Zivilisationskrankheiten.
- Infektionen
- fehlerhaftes Erbgut
- Designkompromisse
- evolutionäres Erbe: stammesgeschichtlich bedingte (relative starre) Designmerkmale des menschlichen Körpers, die an aktuelle Umwelt- und Lebensbedingungen nur unvollkommen angepaßt sein sollen.
Die Theorieabhängigkeit dieser Kategorien wurde bereits in einem früheren Beitrag dargestellt (Lindemann 2000). Im folgenden soll es um die Frage gehen, ob Evolutionsmedizin Ärzten eine Hilfe sein kann, ob also z.B. Studenten in Evolutionsmedizin Vorlesungen hören sollten.
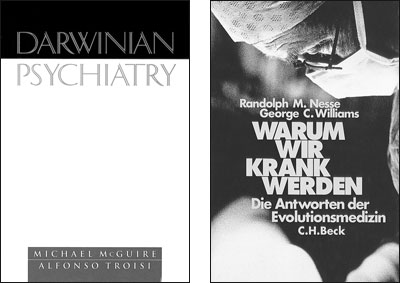 |
| Abb.1: Zwei Buchtitel über Evolutionsmedizin. Das Buch von McGuire & Troisi soll eine neue Psychiatrie begründen: „Darwinistische Psychiatrie“. |
|
Kritik kommt in dieser Hinsicht von medizinethischer Seite: Die dänische Medizinethikerin Anne Gammelgaard stellt Sinn und Nutzen der Evolutionsmedizin grundlegend in Frage (Gammelgaard 2000), obgleich sie keine Zweifel an der Evolutionstheorie hat: Was für den Patienten funktionell ist, ist es nicht automatisch aus evolutionärer Sicht für die Species Mensch – oft im Gegenteil. Ärzte und Evolutionsbiologen haben verschiedene Standpunkte. Behandlung ist evolutionär gesehen oft kontraproduktiv, da damit „schlechte“ Gene überleben. Die Medizin hilft dem Individuum, evolutionstheoretisch ist dagegen die Selektion relevant, die auf unterschiedlichen Ebenen agieren kann: Genom, Organismus, Gruppe von Organismen oder der Species. Für die Begründer der Evolutionsmedizin ist das Genom die zentrale Selektionsebene – sonst machte ihr Ansatz wenig Sinn. Es gibt aber Beispiele für „Interessenkollisionen“ von Genom und anderen Selektionsebenen, z.B. bei der Erbkrankheit Chorea Huntington: Sie bricht gegen Ende der fruchtbaren Periode aus, aber ihre Träger zeigen bereits vorher ein verändertes Sozialverhalten mit vermehrten intimen Beziehungen und damit theoretisch mehr Nachkommen.
Überleben und Fortpflanzung eines Organismus sind nicht identisch mit dem Status „Gesundheit“. Viele Krankheiten stören nicht Überleben und Fortpflanzung, aber das Wohlbefinden, so beispielsweise die Blasenschwäche.
Für Gammelgaard kann das Bestreben der Organismen nach Überleben und Vermehrung nicht aus der Evolutionstheorie abgeleitet werden, sondern ist eine ihrer Voraussetzungen, da es kein intrinsisches Ziel von Lebewesen sei. Überleben und Vermehrung sind Angriffspunkte der evolutionären Prozesse und deshalb im Visier von Evolutionsbiologen und werden daher als das primäre Ziel von Organismen wahrgenommen, ohne es tatsächlich zu sein. Folglich steht die Evolutionsmedizin auf einem zu engen und fragwürdigen theoretischen Fundament, wenn die Entstehung von Krankheiten nur im Zusammenhang mit dem Bestreben des Organismus nach Überleben und Fortpflanzung analysiert wird.
Gammelgaard folgert: Die darwinistische Medizin erklärt unsere Anfälligkeit für manche Krankheiten und kann, basierend auf der Funktion von Gegenreaktionen des Körpers, einige neue Therapieansätze vorschlagen. Aber die evolutionäre Sicht auf die Entstehung und die Bedeutung von Krankheiten ist völlig anders als die medizinische.
Evolutionskritisch wurde ähnlich argumentiert: „Es ist nicht ganz klar, wo der Nutzen einer darwinistischen Medizin für den Patienten liegen soll. Die Autoren würden wahrscheinlich die verbesserte Patienteninformation und -aufklärung nennen. (...) Außerdem erhoffen sich die Autoren (...) Forschungsansätze auf der Basis der erweiterten, finalen Betrachtung mit einem besseren theoretischem Verständnis von humaner Physiologie und Pathophysiologie. Freilich genügt es dafür, generell von einer sinnvollen, zielgerichteten Konstruktion des menschlichen Körpers auszugehen – ohne Annahmen über Konstrukteur und Konstruktionsmethode zu machen“ (Lindemann 2000)
Im „Deutschen Ärzteblatt“ fehlen Beiträge zur Evolutionsmedizin, wie eine Literaturrecherche zeigte – die „Praktiker“ wissen längst, daß diese nicht nur anfechtbar, sondern für sie irrelevant ist.
[Gammelgaard A (2000) Evolutionary biology and the concept of disease. Medicine Health Care and Philosophy 3, 109-116; Kompaktlexikon der Biologie in drei Bänden. Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin, 2001; Lindemann WB (2000) Warum wir krank werden. Die Antworten der Evolutionsmedizin (Rezension). Stud. Int. J. 7, 46-48; McGuire M & Troisi A (1998) Darwinian Psychiatry, Oxford; Nesse RM & Williams GC (1997) Warum wir krank werden. Die Antworten der Evolutionsmedizin. München; Nesse RM & Williams GC (1999) Der evolutionäre Ursprung von Krankheiten, Spektrum der Wissenschaft, Januar 1999, S. 38-46.]
|
|  |